Text: Jutta Berger
Der Text erschien in Ausgabe 2 (03/25).
Lesezeit 3 Min.
Wenn Stoffe Geschichten erzählen
In der Kostümwerkstatt der Bregenzer Festspiele werden künstlerische Entwürfe zum Leben erweckt. Jedes Stück ist ein Unikat, gefertigt mit Präzision und Meisterschaft – von filigranen Stickereien bis zu raffinierten Verschlusstechniken.

Trotz winterlicher Stimmung am Bodensee sind Janina Kobinger und ihr Team gedanklich ganz im Sommer, bei Carl Maria von Webers Der Freischütz und George Enescus Œdipe. Für die Seeaufführung müssen die Gewänder aufbereitet, für die Oper im Festspielhaus stolze 400 Kostüme produziert werden. In der großzügigen, mit viel Tageslicht ausgestatteten neuen Kostümwerkstatt wird emsig geschnitten, genäht, gebügelt. Erste Anproben stehen auf dem Terminkalender. „Es ist immer sehr spannend zu sehen, ob die Umsetzung eines Entwurfs den Ideen der Kostümbildner:innen entspricht und ob das Kostüm auch am Körper funktioniert“, sagt Gewandmeisterin Kobinger. Die Kostüme zum Freischütz gestaltete Gesine Völlm, für Œdipe zeichnet Tanja Hofmann verantwortlich.
Die Anforderungen an Schnitte und Stoffe sind vielfältig. Das Material muss vor allem für die Seebühne den mitunter feuchten Wetterbedingungen standhalten, aber auch maßgeschneidert für die unterschiedliche Nutzung sein. Zehn Menschen arbeiten im Winter in der Kostümwerkstatt, im Sommer wird die Zahl der Schneider:innen, Modist:innen, Ankleider:innen und Schuhmacher:innen auf das Fünf- bis Sechsfache steigen.

Janina Kobinger präsentiert auf dem riesigen Arbeitstisch edle Kleidungsstücke aus dem Freischütz, denen die intensive Nutzung der ersten Festspielsaison nicht anzusehen ist: das Hochzeitskleid von Agathe und zwei Mieder. Sie sind Beispiele für höchste Handwerkskunst: Für das Kleid der unglücklichen Agathe wurde alte Smoketechnik, die man aus der Trachtenschneiderei kennt, angewandt. An Taille und Ärmeln wurde der Stoff zu Wabensmoke gefältelt, gerafft und genäht. Auf jeder der zarten Stoffwaben sitzt eine Glasperle. Jede Perle wurde einzeln von Hand angenäht. Janina Kobinger erklärt den Grund für die Mühe: „Das ist notwendig, damit es bei einem Riss nicht zu einer Kettenreaktion kommt und sich alle Perlen lösen.“
Noch aufwendiger als das Stofforigami beim Hochzeitskleid sind die Mieder in der Herstellung. Gut eine Woche wird an einer Corsage gearbeitet. Den nötigen Halt geben nicht wie früher Fischgräten oder Metallstäbe, sondern Kunststoffeinsätze. Die werden in Körperbänder eingearbeitet und auf den Futterstoff genäht. Eine spitz zulaufende Schneppe lässt die Taille schmaler erscheinen, die Ärmellöcher bleiben offen. Denn die Ärmel werden nicht angenäht, sondern „hineingenestelt“, wie die Gewandmeisterin erklärt.
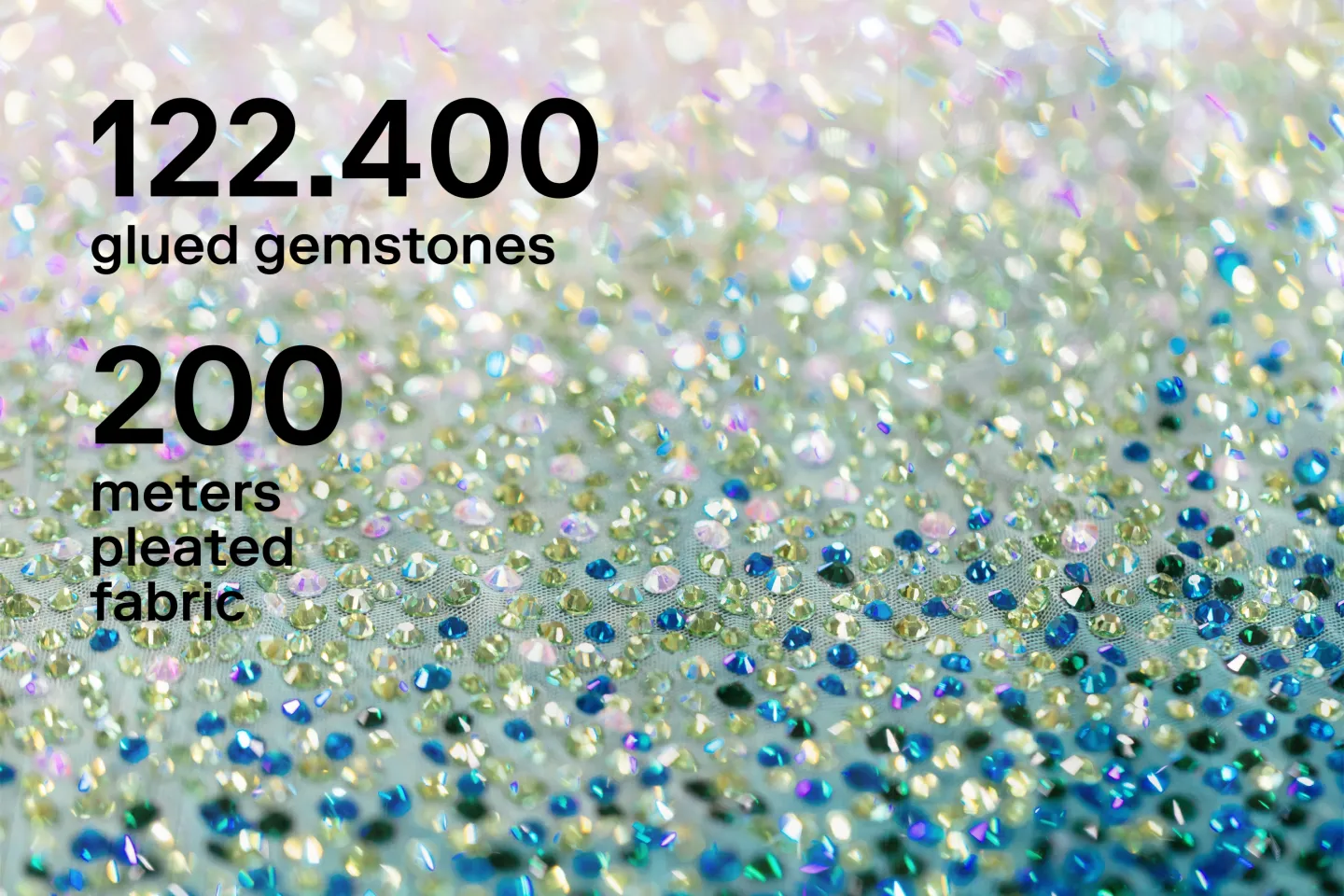
Das Nesteln ist eine sehr alte Verschlusstechnik. Als man weder Reißverschlüsse noch Druckknöpfe kannte, nahm man Schnüre und Bänder, sogenannte Nesteln, die man verknotet hat. Der Vorteil dieser Technik sei die Bewegungsfreiheit und leichtere Adaptierbarkeit, sagt Janina Kobinger. Erst nach der ersten Anprobe wird das Mieder fix genäht, mit einer zusätzlichen Moltonschicht zwischen Futter und Oberstoff, damit nichts durch die feine Seide blitzen oder stechen kann.
Beim Anziehen des Korsetts lassen die Ankleider:innen Gnade walten: „Wir schnüren nicht wie früher“, lacht Janina Kobinger. Als die Frauen noch in Korsette gezwungen wurden, war es üblich, die Taille um acht Zentimeter zu verschmälern. „Wir schnüren maximal zwei Zentimeter“, beruhigt sie.

Regisseur und Bühnenbildner Philipp Stölzl stellt in seiner Freischütz-Inszenierung das Ensemble ins Wasser, was eine besondere Herausforderung für die Schneider:innen ist. Stoffe müssen die Nässe aushalten und die Darsteller:innen sollten die Spielsaison ohne Erkältung überstehen. Janina Kobinger denkt an die kalten Probenwochen zurück: „Wir haben letztes Jahr gelernt, was wir alles mit Neopren machen können.“ Beispielsweise Neoprensocken für das Agieren im überfluteten Bühnendorf.
Janina Kobinger resümiert: „Wir machen mit jeder Inszenierung wertvolle Erfahrungen und lernen dazu.“ Was ihre Arbeit wirklich besonders mache, sei das Bekenntnis der Festspiele zur Qualität. „Wir bekommen hier die Möglichkeit, unsere Handwerkskunst zu leben.“


